

Zieloffene Suchtarbeit
-ZOS-

Suchtbehandlung ist vielfach auf das Ziel lebenslanger Abstinenz ausgerichtet (und darauf beschränkt).

Suchtbehandlung ist vielfach auf das Ziel lebenslanger Abstinenz ausgerichtet (und darauf beschränkt).
Ergänzend dazu hat sich in der niedrigschwelligen Drogenabhängigkeit das Ziel der Sicherung des (gesunden) Überlebens abseits von Abstinenzverpflichtungen etabliert. Behandlungen mit dem Ziel einer Konsumreduktion (Kontrolliertes Trinken/ Rauchen/ Drogenkonsumieren/ Glücksspielen etc.) stellen eine dritte, ergänzende Zieloption dar. Alle drei Zielrichtungen (Abstinenz, Konsumreduktion, Schadensminderung) haben ihre Berechtigung und sollten bei jeder suchtbelasteten Person vorgehalten werden, denn:
1. Nahezu alle Menschen mit einer Substanzkonsumstörung weisen einen problematischen Konsum mehrerer psychotroper Substanzen auf (Alkohol und Zigaretten; Heroin und Alkohol und Zigaretten und Benzodiazepine; etc.) auf
2. und sie verfolgen von Substanz zu Substanz andere Ziele. So kann z.B. ein Drogenkonsument Abstinenz bei Crack, Konsumreduktion bei Alkohol und Tabak und Schadensminderung bei Heroin (Injektion von ärztlich verschriebenem Diamorphin statt Straßenheroin) anstreben.
Als Folgerung ergibt sich: Bei suchtbelasteten Menschen ist
Als Folgerung ergibt sich: Bei suchtbelasteten Menschen ist
1. erstens eine Bestandsaufnahme aller konsumierten Substanzen erforderlich,
2. zweitens eine substanzweise Abklärung der Änderungsziele und
3. drittens das Vorhalten von Behandlungsangeboten, die den Änderungszielen der betroffenen Menschen entsprechen.
Diese drei Bestandteile charakterisieren den Ansatz Zieloffener Suchtarbeit (ZOS). ZOS stellt somit eine grundlegende Art und Weise dar, Suchtarbeit zu verstehen und zu praktizieren.
Die Vorteile von ZOS reichen von der Erhöhung der Erreichungsquote suchtbelasteter Menschen über die Beachtung ethischer Maximen bis zur Verbesserung des Behandlungserfolgs.
Der Ansatz der ZOS hat Relevanz für alle Arbeitsfelder, in denen sich Menschen mit Substanzkonsumstörungen befinden – neben der Suchthilfe im engeren Sinne auch für das medizinische und psychotherapeutische Versorgungssystem, die Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe, (sozial-) psychiatrische Einrichtungen, die Verkehrstherapie u.a.m.

In den vergangenen Jahren haben wir in unseren Implementierungsprojekten viel Erfahrung gesammelt

In den vergangenen Jahren haben wir in unseren Implementierungsprojekten viel Erfahrung gesammelt
Als Ergebnis haben wir mehrere Bausteine zur schrittweisen Annäherung bzw. kompletten Implementierung Zieloffener Suchtarbeit entwickelt.
Wir nennen diese Bausteine nun „ZOS-Bausteine“ und verstehen darunter zentrale Bestandteile Zieloffener Suchtarbeit in der Praxis.
Ein ZOS-Baustein kann dabei mehrere, verschiedene Angebotsformen enthalten, wie etwa ein Webinar, einen Vortrag, Workshops oder mehrtägige Qualifikationen.
Das Grundprinzip in jedem ZOS-Baustein folgt der Logik „von kurzen zu umfangreicheren Angeboten“. Grundsätzlich eignen sich die weniger umfangreichen Angebote für einen kurzen Einblick in die jeweilige Thematik, wohingegen die umfangreichen Angebote (z.B. Workshops und Schulungen) gestuft Kompetenzen für die Veränderung der eigenen Handlungspraxis mit fundiertem Hintergrundwissen vermitteln.
Eine komplette Implementierung Zieloffener Suchtarbeit stellt die Bearbeitung der Kern-Bausteine dar (Strategie-WS, ZOS-Analyse, Einrichtung einer Steuergruppe, Auseinandersetzung mit dem Menschenbild und Suchtverständnis, Konsum- und Zielklärung, Motivierende Gesprächsführung, Interventionen (ZOS-Programmwelt).
Die einzelnen ZOS-Bausteine können aber auch als Ausschnitt des Gesamtprozesses betrachtet werden und je nach Bedarf von interessierten Einrichtungen durchlaufen werden.
Dies ermöglicht auch kleinen Trägern und Einrichtungen den schrittweisen Einstieg in einen Veränderungsprozess in Richtung Zieloffene Suchtarbeit, immer ausgehend von dem Punkt, an dem sie momentan stehen.
Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der passenden ZOS-Bausteine und Ihrem Weg zur Implementierung Zieloffener Suchtarbeit.
Bausteine Zieloffener Suchtarbeit
-ZOS-


ZOS ANALYSE


MENSCHENBILD
UND SUCHTVERSTÄNDNIS


MOTIVIERENDE
GESPRÄCHSFÜHRUNG
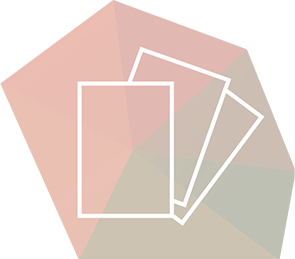

Konsum- und Zielklärung


ZOS-Programmwelt


ZOS-Coaching


Interventionen Alkohol


Interventionen Tabak


Interventionen Illegale Drogen

Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit der Implementierung Zieloffener Suchtarbeit und begleiten Einrichtungen in diesem Prozess, der einen kulturellen Wandel der Gesamteinrichtung darstellt und sich nicht auf Fortbildungen von MitarbeiterInnen beschränkt.

Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit der Implementierung Zieloffener Suchtarbeit und begleiten Einrichtungen in diesem Prozess, der einen kulturellen Wandel der Gesamteinrichtung darstellt und sich nicht auf Fortbildungen von MitarbeiterInnen beschränkt.
Was ist Implementierung?
Von (erfolgreicher) Implementierung ist zu sprechen, wenn ein neuer Arbeitsansatz (z.B. „Zieloffene Suchtarbeit“), ein neues Behandlungsprogramm (z.B. „Change Your Smoking“), eine neue Qualifikation (z.B. “Motivierende Gesprächsführung“) etc. zum festen, ganz selbstverständlichen Bestandteil der alltäglichen Arbeitsabläufe einer Einrichtung geworden ist.
Bei einem Implementierungsprozess, also beim Einführen von Neuerungen, vollzieht die Einrichtung als Ganze einen organisatorischen und kulturellen Wandel („Organisationsentwicklung“) und „stellt sich neu auf“. Es steht somit die Veränderung der Einrichtung im Mittelpunkt und nicht (nur) die Fortbildung einzelner MitarbeiterInnen.
Implementierung Zieloffener Suchtarbeit
Die Neuausrichtung der Arbeit nach dem Ansatz Zieloffener Suchtarbeit stellt eine Herausforderung für Einrichtungen bzw. Träger dar, die bislang rein abstinenzorientiert oder niedrigschwellig gearbeitet haben.
Die Implementierung Zieloffener Suchtarbeit erfordert nämlich die Überprüfung und i.d.R. Veränderung von Suchtverständnis und Menschenbild, Eingangsdiagnostik, Behandlungsangeboten, Außendarstellung u.a.m.
Zur Etablierung dieser Veränderungen reichen Schulungen einzelner MitarbeiterInnen nicht aus, sondern es bedarf eines Einrichtungswandels, der im Rahmen eines Implementierungsprozesses erfolgt.
Am Ende des Implementierungsprozesses Zieloffener Suchtarbeit hat eine Einrichtung/ ein Träger das Prinzip der Zieloffenheit zu ihrer/ seiner Arbeitsgrundlage gemacht (sich zieloffen „aufgestellt“) und sich qualifikatorisch und strukturell weiterentwickelt.
Warum Implementierung Zieloffener Suchtarbeit?
Fortbildungen einzelner MitarbeiterInnen in Zieloffener Suchtarbeit garantieren nicht, dass in einer Einrichtung zieloffen gearbeitet wird. Ein gezielter Prozess der Organisationsentwicklung/Implementierung ist erforderlich, damit Zieloffene Suchtarbeit zum Standard einer Einrichtung/ eines Trägers werden kann.
Zieloffene Suchtarbeit ist bereits Realität geworden ...
In den vergangenen Jahren haben wir einige Träger/ Einrichtungen im deutschsprachigen Raum begleitet, die sich in Richtung einer systematischen Implementierung Zieloffener Suchtarbeit auf den Weg gemacht haben. Dazu gehören der Caritasverband für Stuttgart e.V. (Bereich Sucht- und Sozialpsychiatrische Hilfen; Bereich Armut Wohnungslosigkeit und Schulden), die Evangelischen Wohnheime Stuttgart, Teile der Karlshöhe Ludwigburg, Diakonie Altdorf-Hersbruck-Neumarkt (Sucht- und Sozialpsychiatrische Hilfen) sowie das Soziotherapeutische Wohnheim Sonnenburg in der Schweiz.
Andere Einrichtungen befinden sich im Prozess der Öffnung ihres Arbeitsansatzes in Richtung Zieloffenheit (z.B. das Zentrum für Suchttherapie und Rehabilitation „Mühlhof“ in der Schweiz), Paritätische Nachsorge Sucht in Gilserberg (Hessen), „Reha Löwen“ in der Schweiz.
Begleitung im Implementierungsprozess
Wir planen und begleiten Träger/ Einrichtungen während des gesamten Prozesses der Implementierung Zieloffener Suchtarbeit (und einzelnen ZOS-Bausteinen). Dauer und Umfang sind von der Größe und den individuellen Bedarfen des Trägers/ der Einrichtung abhängig.
Bei Implementierungsprojekten arbeiten wir im Team mit mehreren KollegInnen, die sowohl über inhaltliche Expertise im Bereich Zieloffener Suchtarbeit als im Bereich der Team- und Organisationsentwicklung verfügen.
Gerne beraten wir Sie unverbindlich, wie ein Implementierungsprozess in Ihrer Einrichtung/ bei Ihrem Träger aussehen könnte.

Wir starten mit der ZOS-Cloud – dem sozialen Netzwerk für alle, die sich für das Thema „Zieloffene Suchtarbeit“ interessieren! Bei uns können Sie sich mit Fachkräften, Betroffenen, Angehörigen, Studierenden und allen anderen, die sich für dieses wichtige Thema engagieren, austauschen.

Wir starten mit der ZOS-Cloud – dem sozialen Netzwerk für alle, die sich für das Thema „Zieloffene Suchtarbeit“ interessieren! Bei uns können Sie sich mit Fachkräften, Betroffenen, Angehörigen, Studierenden und allen anderen, die sich für dieses wichtige Thema engagieren, austauschen.
Unsere Plattform bietet zahlreiche Vorteile für unsere Nutzer. Zum einen ist die Registrierung und Nutzung vollständig kostenlos, sodass jeder, der sich für das Thema interessiert, ohne finanzielle Hürden teilnehmen kann. Zum anderen schaffen wir einen Ort des offenen Austauschs und der Unterstützung, wo Erfahrungen, Wissen und Ressourcen geteilt werden können.
Durch die Vielfalt der Mitglieder bieten wir ein breites Spektrum an Perspektiven und Erfahrungen, von denen alle profitieren können. Fachkräfte können neueste Erkenntnisse und Methoden diskutieren, Betroffene finden Unterstützung und Erfahrungsaustausch, und Angehörige erhalten Rat und Informationen. Auch Studierende und Interessierte haben die Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern und sich aktiv in die Diskussion einzubringen.
Darüber hinaus legen wir großen Wert auf Datenschutz und Sicherheit, um unseren Nutzern ein vertrauenswürdiges Umfeld zu bieten. Mit ZOS-Cloud möchten wir eine Gemeinschaft aufbauen, die dazu beiträgt, das Verständnis für zieloffene Suchtarbeit zu fördern und gemeinsam positive Veränderungen zu bewirken. Machen Sie mit und werden Sie Teil unserer wachsenden Community!
-
-
- Erstellen Sie eigene Gruppen, laden Sie selbst Teilnehmende ein und moderieren Sie ihre eigenen Diskussionsforen
- Nehmen Sie Kontakt mit Fachkräften, Betroffenen, Angehörigen, Studierenden etc. auf
- Organisieren Sie ihre Selbsthilfegruppe über die ZOS-Cloud
- Informieren Sie sich über Veranstaltungen online und vor Ort rund um das Thema Zieloffene Suchtarbeit
-
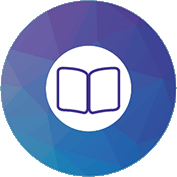
AKTUELLE VERÖFFENTLICHUNGEN
| Körkel, J. (2023a). Geht da noch was? Innovationsbedarf in der Suchthilfe. Rausch. Wiener Zeitschrift für Suchttherapie, 12, 23-34.
| Körkel, J. (2023b). Selbstkontrollierter Substanzkonsum und Zieloffene Suchtbehandlung: Implikationen für die forensische Suchtbehandlung. Recht & Psychiatrie, 41, 9-16
| Körkel, J. (2023c). Zieloffene Suchttherapie – ein patientenorientierter Ansatz. Suchtmedizin, 25, 8-9.
| Querengässer, J., Baur, A., Bezzel, A., Körkel, J. & Schödl, C. (2023). Zieloffenheit in forensischer Suchttherapie – Alternativen zur impliziten Abstinenzorientierung sind rechtlich zulässig und therapeutisch sinnvoll. Recht & Psychiatrie, 41, 3-8
| Körkel, J. (2021a). Kontrolliertes Trinken. So reduzieren Sie Ihren Alkoholkonsum (3., überarb. Neuauflage). Stuttgart: Trias.
| Körkel, J. (2021b). Treating patients with multiple substance use in accordance with their personal treatment goals: A new paradigm for addiction treatment. Drugs and Alcohol Today, 21, 15-30.
| Körkel, J. (2022b). Psychopharmakologische und psychotherapeutische Behandlungsstrategien bei Sucht: Ergänzung oder Gegensätze? JATROS Neurologie & Psychiatrie, 20, 43-47.
| Körkel, J. & Wagner, T. (2021). Abstinenz oder kontrolliertes Trinken? Eine evidenzbasierte Betrachtung zur notwendigen Verhaltensänderung bei alkoholauffälligen Kraftfahrern. Blutalkohol, 58, 211-228.

